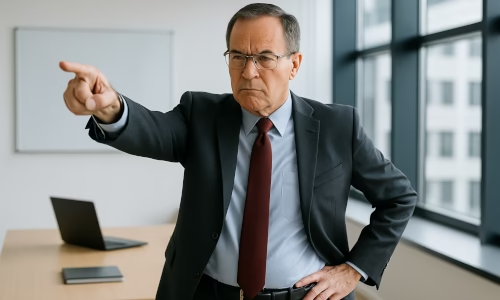Der Umgang mit schwierigen Chefs zählt zu den häufigsten Herausforderungen im Berufsalltag – besonders dann, wenn sich Vorgesetzte wie Feldherren verhalten.
Manche Vorgesetzte wirken, als hätten sie im Geschichtsbuch bei Napoleon, Cäsar oder Clausewitz gelernt, wie man Teams führt. Sie geben Kommandos, erwarten Gehorsam, dulden keinen Widerspruch und definieren ihre Rolle als die des allwissenden Strategen. Solche Führungspersönlichkeiten inszenieren sich gerne als Feldherren, als Anführer auf dem Schlachtfeld des Marktes.
Sie stehen im Mittelpunkt, treffen Entscheidungen im Alleingang und verlangen von ihrem Team vor allem eines: Loyalität.
Wer mit einem solchen Chef zu tun hat, sucht oft verzweifelt nach Antworten: Wie gelingt der Umgang mit schwierigen Chefs? Was tun bei einem cholerischen oder gar narzisstischen Chef, der scheinbar nur sich selbst sieht?
Der Unterschied von situativ autoritärer Führung und autoritärem Führungsstil
Wichtiger Hinweis vorweg: Was ich hier unter „feldherrenhafter Führung“ beschreibe, ist nicht gleichzusetzen mit dem autoritären Führungsstil im Rahmen der situativen Führung. Letzterer ist ein bewusst eingesetztes Werkzeug, das in bestimmten Situationen – etwa bei neuen Mitarbeitenden oder in akuten Krisen – sinnvoll und wirksam sein kann. Er ist zeitlich begrenzt, zielgerichtet und Teil eines flexiblen Führungsrepertoires.
Der „Feldherrn-Stil“, wie ich ihn hier beschreibe, ist hingegen dauerhaft, unabhängig von der konkreten Situation und oft tief in der Persönlichkeit der Führungskraft verankert.
Er entsteht meist nicht aus einem strategischen Kalkül, sondern aus einem inneren Bedürfnis nach Kontrolle, Dominanz oder Selbstschutz. Und genau das macht ihn für Teams so herausfordernd – vor allem, wenn aus dem autoritären Auftreten narzisstische Muster werden. Nicht selten berichten Betroffene, dass ein narzisstischer Chef krank macht – emotional, mental und manchmal auch körperlich.
Vielleicht arbeiten Sie gerade unter einer solchen Führungskraft. Vielleicht beobachten Sie, wie Kolleginnen und Kollegen sich mehr anpassen als mitdenken. Vielleicht fühlen Sie sich selbst zunehmend ohnmächtig oder missverstanden. Und vielleicht fragen Sie sich: Was steckt hinter diesem Führungsstil? Und wie kann man damit umgehen, ohne sich selbst zu verlieren?
Zunächst lohnt sich ein Blick auf die psychologischen Hintergründe.
Ein Chef wie ein Feldherr: eine Schutzstrategie
Viele Menschen in Führungspositionen tragen ein Bild von starker Führung in sich, das sie aus ihrer beruflichen Sozialisation mitbringen. Gerade in traditionellen Branchen galt lange das Motto: Nur wer hart auftritt, wird ernst genommen. Wer Schwäche zeigt, verliert an Autorität. Wer zu viel fragt, gilt als unsicher. Das Bild des Feldherren ist in diesem Kontext ein Symbol für Kontrolle, Klarheit und Handlungsfähigkeit.
Oft steckt dahinter aber auch eine Unsicherheit, die nicht gezeigt werden darf.
Denn wer den Anspruch hat, alles im Griff zu haben, kann schwer zugeben, dass er selbst Orientierung sucht. Der autoritäre Habitus dient dann als Schutzschild. Nach außen wird Dominanz gezeigt – um im Inneren Zweifel zu übertönen.
Typische Merkmale feldherrenhafter Führung:
- Entscheidungen werden zentral und allein getroffen
- Kritik wird als Angriff auf die eigene Person gewertet
- Loyalität wird über Kompetenz gestellt
- Kontrolle ersetzt Vertrauen
- Kommunikation ist vor allem Top-down
Nicht selten findet sich in diesen Strukturen ein Klima der Angst oder der Passivität.
Menschen wagen es nicht, eigene Ideen einzubringen. Kreativität wird blockiert, und statt Selbstverantwortung dominiert Anpassung.
Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Vielleicht erkennen Sie bestimmte Sätze wieder:
„Ich will keine Diskussion, ich will Ergebnisse.“
„Ich hab das schon immer so gemacht.“
„Wenn Sie nicht wollen, dann findet sich jemand anderer.“
Solche Aussagen sind keine Einladung zur Mitgestaltung. Sie markieren Grenzen und Hierarchien. Und genau darin liegt auch die größte Herausforderung: Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter unter einem solchen Chef oder einer solchen Chefin fühlt man sich oft wie ein Spielball statt wie ein Mitspieler.
Umgang mit schwierigen Chefs
Handlungsspielräume erkennen
Trotzdem ist man dem nicht hilflos ausgeliefert.
Es lohnt sich, die eigene Position differenziert zu betrachten. Denn nicht jede autoritäre Führungskraft ist per se unzugänglich. Viele sind durchaus empfänglich für sachliche Argumente, wenn sie nicht als Kritik, sondern als Unterstützung formuliert werden.
Die Kunst besteht darin, das eigene Anliegen so zu verpacken, dass es nicht als Bedrohung empfunden wird.
Ein Beispiel: Statt zu sagen „Das funktioniert so nicht“, können Sie formulieren:
„Ich habe einen Vorschlag, wie wir den Prozess noch effizienter gestalten könnten. Wollen Sie ihn hören?“
Das ist keine Kapitulation, sondern eine kluge Kommunikationsstrategie. Sie zeigt Respekt vor der Hierarchie, ohne sich selbst zu verleugnen. Und sie schafft eine Chance für Dialog.
Sie brauchen Hilfe im Umgang mit einem schwierigen Chef?
Wenn Sie aktuell nicht wissen, wie Sie mit Ihrer Führungskraft umgehen sollen – und vielleicht sogar über eine Kündigung nachdenken –, kann ein gezieltes Coaching dabei helfen, neue Perspektiven zu entwickeln und konstruktive Lösungswege im Umgang mit Ihrem Chef zu finden.
Eigene Grenzen wahren – ein gesunder Umgang mit schwierigen Chefs erfordert Selbstschutz
Gleichzeitig sollten Sie sich darüber klar werden, wo Ihre Grenzen liegen. Wenn der Führungsstil krank macht, wenn Sie permanent unter Druck stehen oder Ihre Werte mit Füßen getreten werden, dann ist ein klarer Schritt notwendig.
Dieser muss nicht sofort in eine Kündigung münden. Aber er kann bedeuten, dass Sie Gespräche suchen, Allianzen bilden oder sich externe Unterstützung holen.
Coaching oder Supervision können helfen, Klarheit zu gewinnen. Auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen können entlasten – vorausgesetzt, sie führen nicht in destruktives Lästern, sondern in konstruktiven Austausch.
Der Blick nach innen – was hat der schwierige Chef mit einem selbst zu tun?
Manchmal lohnt es sich auch, die eigene Reaktion auf den Feldherren-Stil zu hinterfragen. Warum triggert mich dieses Verhalten so stark? Welche Erfahrungen bringe ich selbst mit Autorität mit? Welche Rolle nehme ich im Team ein, und welche wünsche ich mir eigentlich?
Wer diese Fragen ehrlich reflektiert, kann neue Handlungsoptionen entdecken. Vielleicht merken Sie, dass Sie sich zu sehr anpassen. Oder dass Sie zu schnell in den Widerstand gehen.
Beides sind Reaktionen auf ein Machtgefälle – aber nicht die einzigen möglichen.
Strategien im Umgang mit schwierigen Chefs
- Nehmen Sie es nicht persönlich. Auch wenn der Ton scharf ist: Es geht selten um Sie als Mensch.
- Kommunizieren Sie sachlich und professionell. Lassen Sie sich nicht in emotionale Machtspiele hineinziehen.
- Suchen Sie nach sachlichen Anknüpfungspunkten. Wo können Sie Ihre Kompetenz zeigen, ohne zu provozieren?
- Stärken Sie Ihre innere Klarheit. Wer seine Werte kennt, kann leichter für sie einstehen.
- Holen Sie sich Unterstützung. Ob im Team, bei HR oder extern – Sie müssen das nicht allein bewältigen.
Feldherr sein ist kein zukunftsfähiges Modell
In einer Arbeitswelt, die zunehmend auf Zusammenarbeit, Vernetzung und Selbstverantwortung setzt, wirkt der Feldherren-Stil wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Unternehmen, die solche Führung tolerieren oder gar belohnen, laufen Gefahr, ihre besten Leute zu verlieren. Denn die Generationen Y und Z haben andere Erwartungen: Sie wollen Sinn, Mitsprache und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wenn Sie selbst in einer Führungsrolle sind, lohnt sich der ehrliche Blick in den Spiegel: Wie viel Feldherr steckt in mir? Was motiviert mich in meiner Führung? Und wie gehe ich mit Kritik, Unsicherheit und Wandel um?
Denn eines ist klar: Wahre Autorität entsteht nicht durch Lautstärke oder Kontrolle, sondern durch Klarheit, Dialog und Vertrauen. Wer führt, muss nicht alles wissen – aber bereit sein, zuzuhören, zu lernen und Verantwortung zu teilen.
Und wer unter einem Feldherrn arbeitet, ist nicht machtlos. Mit der richtigen Strategie, viel Selbstachtung und klarer Kommunikation lässt sich auch in hierarchischen Strukturen Wirkung entfalten.
Am Ende ist auch das eine Frage der Haltung.
Das könnte Sie auch interessieren: Welche Eigenschaften braucht ein guter Chef? oder Modern Leadership im Wandel: Wie Führungskräfte im DACH-Raum auf aktuelle Herausforderungen reagieren sollten!
Weitere interessante Beiträge zu den Themen Bewerbung, Karriere und Führung finden Sie auf meinem YouTube Kanal!